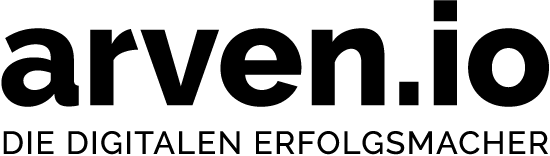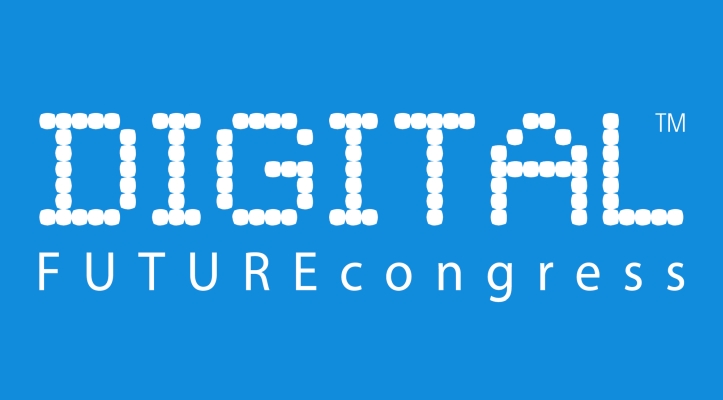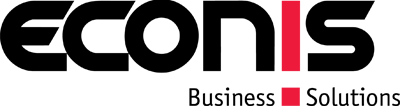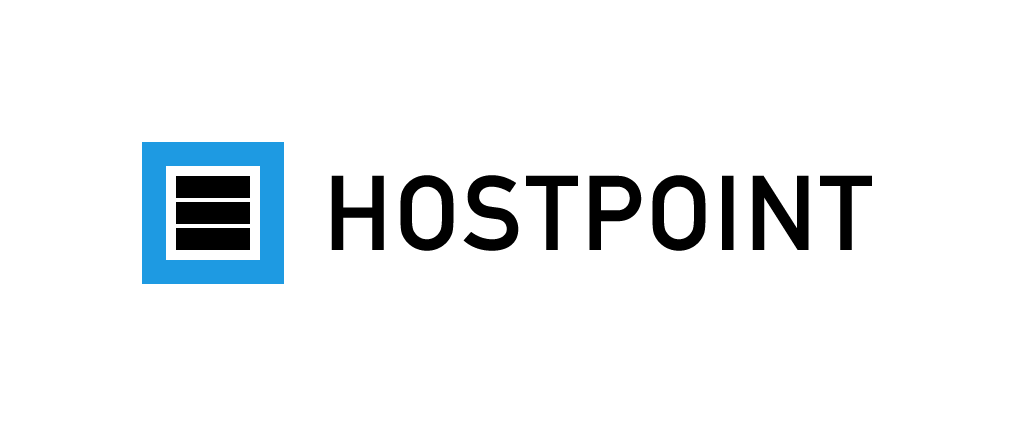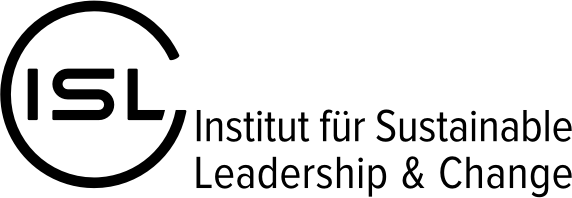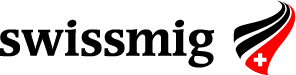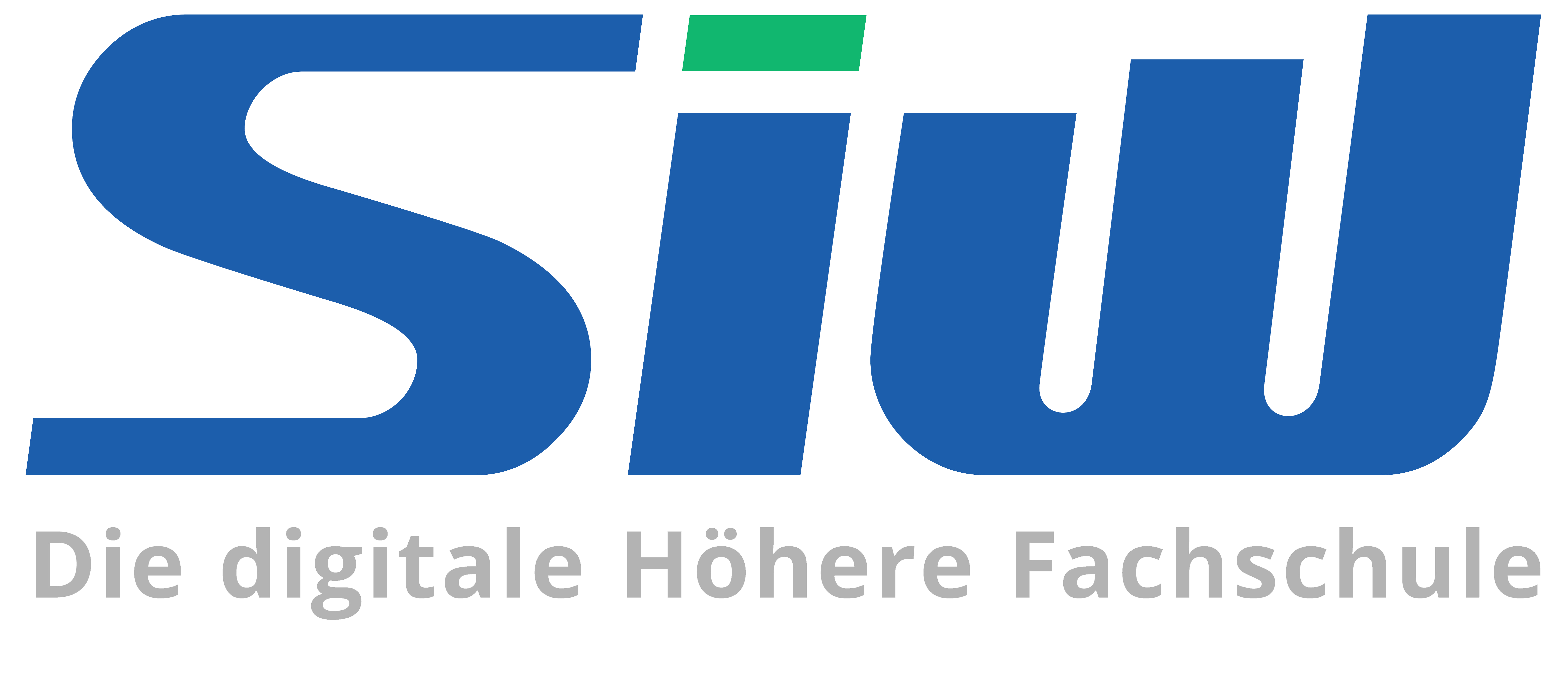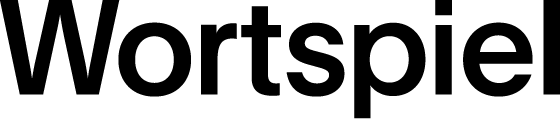Ob der Bund will oder nicht
Vor zehn Jahren als «Selbsthilfegruppe» ins Leben gerufen, ist Swiss Made Software inzwischen zu einer Wirtschaftskraft mit sozialpolitischer Relevanz geworden. Gleichzeitig finden sich interessante Parallelen zu globalen Entwicklungen.
Es ist wie mit dem Pawlowschen Hund: Denkt man an Hard- und Software, kommen einem reflexartig das Silicon Valley und amerikanische Grossmächte wie Google, Facebook, Microsoft oder Apple in den Sinn. Der Blick aufs eigene Smartphone relativiert jedoch die Perspektive. Da fallen plötzlich Apps von SBB, MeteoSwiss, local.ch oder Zattoo und Doodle sowie viele andere ins Auge. Damit entwickelt sich der Softwaremarkt wie andere auch: Neben den dominierenden globalen Brands (Coca-Cola) hat es immer auch Platz für lokale Champions (Ramseier, Rivella). Letztere trotzen nicht nur seit Jahren dem Globalisierungstrend, sondern erhalten im Zuge jüngster Skandale rund um (angebliche) Manipulationen auf einschlägigen Social Media-Plattformen während den amerikanischen Präsidentschaftswahlen eine neue Bedeutungsdimension: Swiss Made Software könnte in Zukunft jenes Vertrauen schaffen, das die grossen Player derzeit gerade verspielen.
500-mal swiss made software
Was vor 10 Jahren gewissermassen als Selbsthilfe-Marketingaktion gegen die US-Vormachtstellung begann, repräsentiert heute eine wachsende Wirtschaftskraft von zunehmend auch politisch strategischer Bedeutung. 500 Softwareunternehmen haben sich inzwischen dem Label angeschlossen. Zusammen beschäftigen sie mehr als 10’000 Mitarbeitende. Allein im 2017 konnten über 100 neue Labelträger gewonnen werden, darunter viele Start-ups. Mit anderen Worten: die Schweizer Softwarebranche lebt – und wie!
Als swiss made software 2007 seinen Ursprung nahm, war die Wahrnehmung aber noch eine ganz andere. So ging es dem Gründer des Labels, Unternehmer Luc Haldimann, in erster Linie darum, ein (Selbst-)Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der einheimische Softwarewerkplatz durchaus in der Lage ist, Produkte von Weltformat hervorzubringen. Davon zeugten nicht nur einige stark prosperierende Software-Schmieden, sondern auch bedeutende Übernahmen durch Industrieschwergewichte wie Adobe (Day Software), Microsoft (Media Streams) und Google (Endoxon) oder Open Text (Obtree). Nur war dies in der (ver)öffentlich(t)en Meinung zu wenig bekannt. Dass etwa sämtliche Core-Libraries des Android Smartphone-Betriebssystems für Google von Noser Engineering entwickelt wurden und somit in neun von zehn Smartphones auf der Welt eine gute Portion Swiss Made Software steckt, bleibt bis heute wohlbehütetes Geheimwissen – ausserhalb der lokalen ICT-Branche interessierte dies weder Medien noch Politik.
Ein neues wirtschaftliches Selbstverständnis
Diese Haltung änderte sich im Ausgang der Nuller-Jahre markant. Im Nachklang der Finanz- und Bankenkrise befand sich plötzlich auch die offizielle Schweiz auf der Suche nach einem neuen wirtschaftlichen Selbstverständnis. Wurde in den 90er Jahren noch stark auf Dienstleistungen rund ums Finanzgeschäft gesetzt, entdeckte man jetzt in der auf IT-Hightech basierenden Innovationskraft das zukünftige Wertschöpfungspotenzial des Landes. Damit wurden die Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) zum festen Bestandteil sämtlicher landauf, landab propagierten Wirtschaftsentwicklungsoffensiven.
Dies gab auch dem Label swiss made software einen neuen Spinn: Aus der «Selbsthilfegruppe» wurde ein wirtschaftsstatistisch anerkannter (wenn auch kaum erfasster) Wirtschaftsfaktor. Fakt ist, dass sich die Labelträger trotz zu erwartendem rückgängigem Auftragsvolumen aus ihrer Kernzielbranche, der Finanzindustrie, mehr als nur wacker behaupteten: Praktisch sämtliche swiss made software-Unternehmen legten in punkto Mitarbeitende und Umsatz kontinuierlich zu. Dies zeigt sich auch in den branchenweiten offiziellen Beschäftigungszahlen: Arbeiteten 2001 noch 140’000 Personen in der ICT-Branche, waren es 2015 über 210’000.
Krisenresistenz war und ist ein gefragtes Gut. So ist es wohl kein Zufall, dass 2010 die Initiative eZürich ins Leben gerufen wurde und «Downtown Switzerland» zum europäischen Silicon Valley proklamierte. Obwohl man sich mit diesem Ansinnen zusammen mit weiteren geschätzten hundert «Nachahmer-Valleys» in beste globale Konkurrenz begab, reifte die Initiative heran und konnte 2016 unter dem Label «Digital Switzerland» und mit bundesrätlichem Segen nationalisiert werden.
Blockchain-Craze und Bitcoin-Hausse
Auch der gebeutelten Finanzbranche gelang der Turnaround – zumindest in der Perzeption. Fand der mit Risikokapital vorangetriebene Fintech-Trend zunächst noch andernorts statt, gelang es, den auf der Bitcoin-Hausse reitenden «Blockchain-Craze» zu einem bedeutenden Teil in hiesige Gefilde zu locken. Crypto-Valley und Finma sei Dank, hat sich die Schweiz inzwischen auf dem Fintech-Radar mehr als nur bemerkbar gemacht.
Ebenfalls prächtig, wenn auch gemessen am Silicon Valley auf praktisch vernachlässigbarem Niveau, entwickelte sich die Start-up-Kulisse. Während der Dotcom-Boom anders als in Deutschland und natürlich den USA nur moderat Spuren hinterliess, änderte sich dies in den letzten Jahren. So verdreifachte sich das Investitionsvolumen seit 2012 von 124 Millionen Franken auf fast 372 Millionen im 2017. Gleichzeitig stieg die Zahl der Finanzierungsrunden von 26 auf 102.
Doch so, wie sich die Schweiz auf das Thema Digitalisierung eingeschworen hat, verliert der vorbehaltlose Technologieglaube andernorts mehr und mehr seine Anhänger. Dies zeichnete sich über die vergangenen Jahre bereits ab.
Angefangen 2013 mit den SnowdenEnthüllungen, erreicht die Ungemütlichkeit bei der Frage «Was machen die Silicon Valley-Mogule und die US-Regierung mit meinen Daten?» im Anschluss an die Fake News-Debatte und die Enthüllungen rund um Facebook und Cambridge Analytica derzeit ihren Höhepunkt.
Von Digital Natives zu Digital Dissidents
Das Timing könnte nicht besser sein: Just in dem Moment, als nicht wenige Digital Immigrants die Digital Natives dazu aufrufen, zu Digital Dissidents zu werden, greift die EU mit dem Inkrafttreten der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) zünftig in die Regulierungskiste und kündigt bei fahrlässigem Umgang mit Daten drakonische Strafen an. Wichtiger noch – und vielfach hierzulande unbeachtet, wenn nicht verachtet – ist in der neuen Verordnung indes die Festschreibung des Rechts auf Datenübertragung.
Ob mit oder ohne Künstliche Intelligenz, Algorithmen bestimmen mehr und mehr die Märkte und das öffentliche wie auch private Leben. Algorithmen und Künstliche Intelligenz brauchen zu ihrer gesunden Entwicklung aber vor allem eines: Daten, richtig viel Daten. Ein Blick auf die Welt genügt, um ernüchtert festzustellen, dass dieser neue Rohstoff derzeit sehr ungleich verteilt ist: Nämlich in den USA und in China. Anders als beim Erdöl müsste dies jedoch nicht so sein: Genau hier setzt das Recht auf Datenübertragung an.
Dass dieses Recht technisch nicht ganz trivial umzusetzen sein wird, liegt in der Natur der Sache. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass die Datenportabilität entscheidend wird für die Frage, ob Märkte mit fortschreitender Digitalisierung offen und damit selbstregulierend bleiben. Denn nur wenn Daten übertragbar sind, können Lock-ins (wie sie die IT-Industrie nur allzu gut kennt) bei datenbasierten Services vermieden werden. Nur so ist ein Wechsel von einem Anbieter zum anderen, und damit Wettbewerb, überhaupt möglich. Betreffen diese Daten «nur» mein Einkaufsverhalten oder meine Musikvorlieben, so ist dies gerade noch tolerierbar, wenn auch zähneknirschend. Bei Themen wie Digital Health oder Smart City sollten indes die Warnlampen grell blinken.
Datenportabilität und Wettbewerb
Gerade bei der Datenfrage hat die Schweiz als sicherer Hafen einiges zu bieten. Gewisse Pflöcke wurden schon eingeschlagen, so das Thema Open Data: 2012 stellte die Stadt Zürich als erste in der Schweiz Teile ihres Datenbestands öffentlich und gratis zur Verfügung.
2014 folgte die passende Strategie des Bundes – «Open Government Data-Strategie Schweiz». Weitere private Projekte im Gesundheitsektor sind Healthbank und Midata. Beide verfolgen das Ziel, die Datenfrage genossenschaftlich zu lösen und den UserInnen, qua Anteilschein, das Selbstbestimmungsrecht über ihre Gesundheitsdaten zu ermöglichen.
Die Rechnung könnte aufgehen. Je mehr der User über seine Daten bestimmt, umso freier kann er Dritten Zugang gewähren. Dies wiederum senkt die Eintrittshürden für Entwickler, neuartige Softwaredienstleistungen basierend auf Algorithmen und AI anzubieten. So gesehen, und falls die Weichen richtig gestellt werden, könnten sich ganz neue Innovationsbiotope entwickeln.
Zu befürchten ist, dass es noch eine Weile dauert, bis dies auf höchster Ebene ankommt. So ist es ausgerechnet die Datenportabilität, mit der sich der Bundesrat schwertut. In der Revision das Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG) hat man vorerst darauf verzichtet, zu übernehmen, was auf EU-Ebene im Rahmen der oben erwähnten DSGVO festgeschrieben wurde.
Es stellt sich also die Frage: Wie wichtig ist Swiss Made Software der Schweizer Politik?